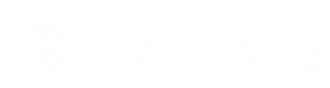darwin upheaval hat geschrieben:Myron hat geschrieben:Ohne wahre Sätze kein wahrer Glaube, und ohne wahren Glauben kein Wissen!
Das ist aber kein Argument, sondern das mantraartige Wiederholen dessen, was Du definitionsgemäß Deiner Argumentation zugrunde legst.
Ich wiederhole mich nur deshalb "mantraartig", weil du weiterhin das Offensichtliche leugnest,
das weder von den Fallibilisten noch von den Infallibilisten unter den Erkenntnistheoretikern in Abrede gestellt wird, nämlich, dass Wahrheit eine notwendige Bedingung für Wissen ist.
"If we interpret ['If you know p, then you can't be wrong'] as 'Necessarily, if one knows that p, then p is true', then it simply states that knowledge requires truth, which fallibilism does not deny."("Fallibilism." In
A Companion to Epistemology, edited by Jonathan Dancy, Ernest Sosa, and Matthias Steup, 2nd ed., 370-375. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2010. p. 372)
darwin upheaval hat geschrieben:Die Wissenschaftsgeschichte hat es gezeigt: es gibt nur "hypothetisches", bestenfalls partiell wahres aber niemals sicheres Wissen. Deshalb normierst Du Dein begriffliches System streng genommen an der Praxis der Naturwissenschaften vorbei.
1. Mir ist die Bedeutung des Begriffs "Teilwahrheit" nicht klar. Worin unterscheidet sich ein "ganz wahrer" Satz von einem "teilweise wahren"?
2. Das Unsichere am "fehlbaren Wissen" besteht darin, dass die Gründe G, die für eine Hypothese H sprechen, dessen Wahrheit nicht "nezessitieren", d.h. nicht logisch implizieren, sodass sowohl G & H als auch G & ~H möglich ist. Die Fallibilisten sind der Meinung, dass man auch dann behaupten darf zu wissen, dass H, wenn der Fall G & ~H
möglich ist. Sie behaupten
nicht, dass man auch dann wissen kann, dass H, wenn dieser mögliche Fall der wirkliche ist, d.h. sie behaupten, wie gesagt, nicht, dass man wissen kann, dass H, wenn ~H.
darwin upheaval hat geschrieben:Kann man Deinen Worten entnehmen, dass Du hier erstmals einräumst, dass es fehlbares (und damit falsches) Wissen geben kann?
Wenn "falsches Wissen" bedeutet, dass man wissen kann, dass p, wenn ~p, dann gibt es kein falsches Wissen, da es keinen falschen wahren Glauben gibt.
darwin upheaval hat geschrieben:Das würde aber Deiner Definition widersprechen, weil Du "Wissen" mit dem Begriff des Wahren und des Sicheren verbindest. Folglich können Wissenschaften kein Wissen zutage fördern (zumindest kein Wissen, das wir als solches erkennen).
"Es ist immer von Gnaden der Natur, wenn man etwas weiß."(L. Wittgenstein,
Über Gewissheit, §505)
Ein Wissenschaftler weiß nicht, dass eine Hypothese H wahr ist, wenn sie falsch ist. Ob sie wahr ist oder nicht, kann er natürlich nur anhand der vorliegenden Beweise beurteilen, die für sie sprechen. Wenn jene Beweise jedoch sowohl mit H als auch mit ~H vereinbar sind (was die Fallibilisten annehmen), dann kann er letztlich nur
hoffen, dass sein gerechtfertigter Wissensanspruch der Wirklichkeit entspricht, d.h. dass es tatsächlich der Fall ist, dass H. Denn wenn dies nicht der Fall ist, d.h. wenn es stattdessen der Fall ist, dass ~H, dann ist sein "Vermutungswissen" nur Scheinwissen und damit eigentlich Nichtwissen, das er als solches aber nur dann durchschauen kann, wenn sich später unerwarteterweise herausstellt, dass sein wohlbegründeter Glaube an die Wahrheit von H doch falsch ist.
Wer auf Vermutungswissen, auf fehlbares Wissen setzt, der geht zwangsläufig ein epistemisches Risiko ein.
Übrigens, leider ist auch der Fallibilismus nicht gegen die berühmt-berüchtigten Gettier-Fälle gefeit, die zeigen, dass selbst
wahres und gerechtfertigtes Glauben nicht per se Wissen ist. Ein Beispiel:
Ich habe Lotto gespielt, und bevor ich mich nach den gezogenen Zahlen erkundige, sage ich zu einem Freund: "Ich glaube, ich habe nichts gewonnen." Angesichts der äußerst niedrigen Gewinnwahrscheinlichkeit ist dieser Glaube in sehr hohem Maße gerechtfertigt. Dann stelle ich fest, dass ich tatsächlich nichts gewonnen habe und meine Glaube somit wahr ist. Heißt das, dass ich
gewusst habe, dass ich nichts gewonnen habe? Schließlich ist mein Glaube sowohl gerechtfertigt als auch wahr, und wenn Wissen wahrer und gerechtfertigter Glaube ist, dann muss hier doch ein Fall von Wissen vorliegen, oder nicht?
Überraschenderweise wird dies von fast allen Erkenntnistheoretikern verneint, weil sie meinen, dass es lediglich einem glücklichen Zufall zu verdanken ist, dass mein Glaube, nichts gewonnen zu haben, wahr ist; denn er hätte ja genauso gut falsch sein können, da die Gewinnwahrscheinlichkeit zwar äußerst gering, aber eben nicht gleich Null ist.
Solche Gettier-Fälle zeigen, dass zur Wahrheit und Begründetheit eines Glaubens eine weitere notwendige Bedingung hinzukommen muss, damit er zu echtem Wissen wird.
Welche das ist, ist immer noch ein weitgehend ungelöstes Grundproblem der zeitgenössischen Erkenntnistheorie.
darwin upheaval hat geschrieben:Wissen konstituiert sich aber durch Gehirnprozesse und kann demnach nicht von der Existenz von Tatsachen abhängen, die jenseits dieser Gehirnprozesse existieren.
Die Wahrheit des repräsentationalen Inhalts zerebraler Wissenszustände hängt durchaus von außenweltlichen Tatsachen ab. Außerdem werden Glaubens- und Wissenszustände von äußeren Ereignissen oder Vorgängen kausal beeinflusst.
(Äußere Geschehnisse rufen in mir bestimmte Wahrnehmungen hervor, die wiederum die Grundlage eines entsprechenden Glaubens bzw. Wissens bilden.)
darwin upheaval hat geschrieben:Ein Wesen A, das Tatsache "x" als Tatsache "y" erkennt, kann nur einem Satz über "y" eine Wahrheit zuschreiben und um die Existenz von "y" wissen, aber nicht um die Existenz von x, das für es (möglicherweise grundsätzlich und für alle Zeiten) verborgen bleibt. Das Wissen um die Eigenschaften von y wäre demnach nur ein Scheinwissen, wohingegen ich behaupte, es handele sich um echtes (wenn auch immer nur um partiell korrektes) Wissen.
Das verstehe ich nicht.
Gehst du von der kantischen Unterscheidung zwischen "phänomenon" ("Erscheinung") und "noumenon" ("Ding an sich") aus?
darwin upheaval hat geschrieben:…Da wir die Welt nie so erkennen, wie sie wirklich ist, gibt es Deiner Definition nach überhaupt kein Wissen.
Ich teile deine Prämisse nicht.
Die Welt ist zwar in der Tat nicht immer so, wie sie scheint, aber das heißt nicht, dass sie
niemals so ist, wie sie scheint.
Wenn ich zum Beispiel einen Ball sehe, dann erscheint er rund und er
ist auch rund.
Oder ein Beispiel aus der Wissenschaft: Wasser besteht aus H2O-Molekülen, und du wirst doch sicher nicht bestreiten, dass die Chemiker dies erfolgreich erkannt haben, oder? Was soll man dann aber mit der folgenden Äußerung anfangen: "Wir wissen, dass Wasser aus H2O-Molekülen besteht, wenngleich Wasser
nicht wirklich aus H2O-Molekülen besteht." ?
darwin upheaval hat geschrieben:Der Wahrscheinlichkeitsbegriff kann Deinen Wissensbegriff auch nicht retten, weil nach Popper die induktive Logik, auf die sich die Wahrscheinlichkeit stützt, versagt.
Ich versuche gar nicht, "meinen" Wissensbegriff mithilfe des Wahrscheinlichkeitsbegriffs zu "retten". Nichtsdestoweniger spielt er bei der Hypothesenbegründung eine zentrale Rolle:
"Non-Deontological Justification (NDJ)
S is justified in believing that p if and only if S believes that p on a basis that properly probabilifies S's belief that p."(
http://plato.stanford.edu/entries/epistemology)
Und das ist so ungeachtet der theoretischen Problematik, dass
"[i]f we wish to pin down exactly what probabilification amounts to, we will have to deal with a variety of tricky issues."darwin upheaval hat geschrieben:Auch wenn wir 1.000.000 schwarze Amseln beobachten, ist dies kein Garant dafür, dass die 1.000.001. Amsel nicht doch weiß ist. Daher halte ich übrigens auch vom Bayesianischen Ansatz wenig. Die Bayes-Schätzung beruht nicht auf einer logisch gültige Deduktion, und die A-priori-Wahrscheinlichkeiten sind nichts anderes als Grade des "Für-wahr-Haltens" bestimmter Ereignisse.
Es gibt bekanntlich unterschiedliche Interpretationen des Wahrscheinlichkeitsbegriffs:
http://plato.stanford.edu/entries/probability-interpretTrotz aller analytisch-interpretatorischen Schwierigkeiten beim Umgang mit dem Wahrscheinlichkeitsbegriff kommen wir nicht umhin, ihn zu verwenden, wenn es um die evidenzrelative Bewertung von Hypothesen geht. Hier spielt vor allem der Begriff der bedingten Wahrscheinlichkeit eine maßgebliche Rolle.