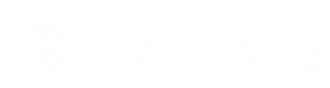Ich habe das Konzept mit der "Prüfinstanz" offenbar noch nicht richtig
verstanden.
Na ja, das mit der "Prüfinstanz" hört sich so hochtrabend an, ist aber eigentlich ganz simpel.
Damit ist nichts anderes gemeint, als in der Realität auszuprobieren, ob etwas funktioniert.
Man denkt sich also Regeln aus. Die hat man zunächst nur im Kopf, als "Theorien". Dann wendet
man sie in der Praxis an, d.h. im realen Zusammenleben. Mit diesem Anwendungsversuch testet
man, ob eine Regel
tatsächlich (also nicht nur theoretisch) dazu führt, dass man einer
vorher akzeptierten regulativen Idee näherkommt. Man "prüft" die Regeln also, indem man sie
praktisch im realen Zusammenleben anwendet. Diese Prüfung findet mittels Anwendung, also in der
Realität statt. Deswegen ist die Realität die "Prüfinstanz". Sie liefert uns Informationen
darüber, ob eine Regel funktioniert oder nicht.
Man kann sich das vielleicht noch leichter bei wissenschaftlichen Theorien vorstellen. Man
stellt die Theorie auf: "Dieser Stein fällt zu Boden, wenn ich ihn loslasse". Diese Theorie
überprüft man, indem man den Vorgang
praktisch durchführt. Die Realität "zeigt" uns
dann, ob die Theorie falsch ist. Sie ist also die "Prüfinstanz". Wenn der Stein losgelassen
wird und er nicht zu Boden fällt, ist die Theorie falsch. In der Ethik ist es natürlich etwas
komplexer zu beurteilen, ob einen eine bestimmte Regel tatsächlich einer bestimmten regulativen
Idee näherbingt. Das Testen ist also unter Umständen schwieriger. Das Schema ist aber m.E. das
Gleiche.
Hier (Abschnitt "Antipositivismus") wird das mit der "Prüfinstanz" anhand einiger Beispiele
erläutert. Vielleicht wird dadurch die Idee deutlich, die dahintersteckt.
Nehmen wir mal die von dir erwähnte regulative Idee "gottgefälliges Zusammenleben". Wir
können Regeln zum Erreichen dieses Ideals finden. Inwiefern scheitert dieses Ideal dann an der
"Prüfinstanz" Realität/Natur? (oder tut es das nicht?)
Das mit dem "gottgefälligen Zusammenleben" war wohl kein besonders verständliches Beispiel von
mir, da in diesem Fall ja extrem schwierig zu bestimmen ist, was damit auch nur ännähernd
gemeint sein soll. Es wird ja impliziert, dass "Gott" tatsächlich einen Willen hat und dass man
diesen Willen kennt. Den kennt man aber nicht, weil es Gott nicht gibt.
Ich finde das Beispiel "Leidminimierung" für eine regulative Idee einfacher, weil die schon
etwas besser erfassbar ist. Also, gehen wir davon aus, dass eine Gruppe von Menschen diese
regulative Idee akzeptiert hat. Sie stellen dann auf dieser Basis die konkrete Norm auf: "Wir
verprügeln uns nicht." Die Norm wird dann praktisch angewandt und die Menschen halten sich
daran. Sie merken, dass die Norm tatsächlich dazu beiträgt, ihr Leid zu minimieren, weil durch
sie Prügeleien (die ja Leid verursachen würden) vermieden werden. Die Norm ist also der
Annäherung an die regulative Idee dienlich; sie hat sich bewährt.
Gleichzeitig einigt sich eine andere Gruppe von Menschen, die sich ebenfalls auf die regulative
Idee der Leidminimierung geeinigt hat, auf die konkrete Regel "Prügeleien in der Kneipe sind
erlaubt". Sie sehen aber, nachdem die Norm einige Zeit angewendet wurde, dass die Prügeleien in
der Kneipe viel Leid verursachen. Die Norm trägt also
nicht dazu bei, sich der reg. Idee
der Leidminierung anzunähern. Sie hat sich also
nicht bewährt. Sie hat die Prüfung in
der Realität nicht bestanden und wird deswegen fallengelassen. Die Gruppe denkt sich nun neue
Regeln aus und überprüft abermals, ob diese sich vielleicht besser in der Realität bewähren als die
fallengelassene Regel usw.