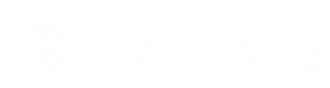Cui bono?
Warum das Gute nicht nur auf dem Papier stehen sollte…
Die Geschichte der Menschheit wird nicht von hehren Idealen bestimmt, sondern von eigennützigen Interessen.1 Vorstellungen, die mit dem Eigennutz der Individuen nicht korrespondieren, werden sich niemals durchsetzen können, so gut begründet oder “ehrenhaft” sie auch immer erscheinen mögen. Eine Binsenweisheit, gewiss. Allerdings wurde sie bislang, so mein Eindruck, von den freigeistig-säkularen Kräften nicht in ausreichendem Maße berücksichtigt. In unserem Lager scheint vielfach noch die idealistische Vorstellung vorzuherrschen, dass man bloß aufzeigen müsste, inwiefern die säkulare Alternative vernünftiger, logisch konsistenter, empirisch gesicherter sei als die religiösen Heilserzählungen, um die Menschen nachhaltig zu überzeugen.
Ich gebe freimütig zu, dass ich früher ganz ähnlich dachte. Aber dieser Zahn wurde mir schon vor einigen Jahren gezogen, u.a. von jenem freundlichen “Weichfilter-Christen”, der nach einem Vortrag (ich denke, es war irgendwo in Bayern) auf mich zukam und etwa das Folgende zum Besten gab: “Was Sie da in Ihrem Vortrag gesagt haben, Herr Schmidt-Salomon, das klang alles wirklich vernünftig, und ich weiß auch gar nicht, was ich dem logisch entgegensetzen sollte. Aber ich frage Sie: Was bringt das mir persönlich? Was habe ich davon, wenn ich aus der Kirche austrete? Gut, ich spare die Kirchensteuer, aber würden insgesamt nicht doch die Nachteile überwiegen? Ich lebe in einer Kleinstadt, die meisten Menschen in meiner Umgebung sind Kirchenmitglieder und mein Jüngster geht gerade in einen katholischen Kindergarten…”
Es sind vielfach solche Fragen des persönlichen Alltags, die die Menschen beschäftigen und die sie davon abhalten, ihrer Kirche den Rücken zu kehren. Dass die religiösen Lehren hoffnungslos überholt sind, das haben mittlerweile doch die allermeisten schon begriffen.2 Mögen einige Politiker und medialen Hofbericht-erstatter noch vor dem Papst demütig niederknien, für viele sog. “Christen” ist Benedikt XVI. nichts weiter als ein abergläubischer alter Mann in seltsamen Gewändern, ein “Promi” unter vielen, nicht mehr.3 Was die Kirchenmitgliedschaft für diese Menschen attraktiv macht, das sind nicht theologische, sondern lebenspraktische Erwägungen: Würde ich mich durch einen Kirchenaustritt nicht in eine gesellschaftliche Außenseiterposition begeben? Würden meine Kinder, wenn ich sie nicht taufen lasse, einen guten Kindergartenplatz bekommen? Sind Konfessionsfreie im Berufsleben nicht benachteiligt? Was passiert, wenn ich krank, alt und schwach bin? Werde ich dann womöglich in einer kirchlichen Institution (Krankenhaus, Pflegedienst, Altersheim) landen und wie wird man mich dort behandeln, wenn die Verantwortlichen mitbekommen, dass ich ihrem “Verein” nicht angehöre?
Manche dieser Ängste sind einigermaßen unbegründet, manche jedoch leider nicht. Tatsächlich stehen Menschen, die im sozialen oder medizinischen Sektor tätig sind, unter dem Damoklesschwert der “Zwangskonfessionalisierung”.4 Es ist nun einmal nicht von der Hand zu weisen, dass Caritas und Diakonie die größten nichtstaatlichen Arbeitgeber Europas sind und in manchen Gegenden im Sozialsektor geradezu eine Monopolstellung aufgebaut haben.5 Von daher verwundert es nicht, dass es in jüngster Vergangenheit bereits einige Fälle gab, in denen die freundlichen Berater vom Arbeitsamt mit sanftem Druck ihre “Klienten” zum Kircheneintritt überreden wollten, um so ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen. “Sofortiger Kircheneintritt oder Streichung der staatlichen Leistungen!” – es ist manchem CSU-Politiker durchaus zuzutrauen, dass er Derartiges irgendwann einmal öffentlich propagiert. (Vor meinem geistigen Auge erscheinen schon “Wirtschaftsweise”, die mit sorgenschwerer Miene und bewaffnet mit den dafür geeigneten Statistiken erklären, “dass wir uns all die konfessionslosen Sozialpädagogen, Mediziner, Pfleger und Erzieherinnen nicht mehr leisten können”. Und natürlich darf auch der gute Kardinal Meisner in einem solchen Szenario nicht fehlen. Man kann sich leicht vorstellen, wie der gute Mann der BILD-Zeitung gegenüber sein Herz ausschüttet: “Warum, bei Gott, sollten wir Leute durchfüttern, die sich zu fein dafür sind, den Leib des Herrn zu verspeisen?!”)
Scherz beiseite, die Lage ist ernst genug. Es sieht nicht nur im Sozialsektor, sondern auch auf vielen anderen Gebieten, etwa im Bereich der Medien oder im akademischen Spektrum, einigermaßen düster aus. So gibt es kaum etwas, was die akademische Karriere eines jungen, rational denkenden Wissenschaftlers stärker gefährden könnte als offen vorgetragene Religionskritik, ein Phänomen, das ich einst mit dem Begriff “Feuerbach-Syndrom” gekennzeichnet habe.6 Gewiss: In den Wissenschaften stimmen uns viele in punkto Religionskritik zu, aber – um einen Ausspruch eines ehemaligen Kollegen von der Universität Trier zu zitieren: “Wer ist schon so blöde, so etwas offen zuzugeben?” Was würden da die Kollegen denken? Würde man dann noch eine Einladung in die Akademie X oder Y bekommen? Wohl kaum! Man könnte das entscheidende Grundproblem der säkularen Szene vielleicht so formulieren: Zwar kann man heute unter günstigen Umständen ein gesichertes Einkommen erwirtschaften trotz eines humanistisch-säkularen Engagements, jedoch kaum dank eines solchen Engagements.
Auf kirchlicher Seite sieht die Lage völlig anders aus. Wer, entsprechende Befähigung zum Beruf vorausgesetzt, sich klar und eindeutig zum Christentum bekennt, der kann sich vor Stellenangeboten kaum retten. Es ist dabei keineswegs so, dass Wissenschaftler, Philosophen oder Künstler von der intellektuellen oder ethischen Strahlkraft des Christentums angezogen würden, es sind vielmehr die von den Kirchen bzw. zum Großteil auch vom Staat bereitgestellten enormen finanziellen Mittel, die es so attraktiv machen, sich als tätiger Mensch irgendwo im weit gefächerten Umfeld der Religion zu verorten.
Wie ich aus den wenigen empirischen Untersuchungen, die es zu diesem Thema gibt, vor allem aber aus der kaum mehr zu überblickenden Masse von persönlichen Schreiben, die mich in den letzten Jahren erreichten, schließe, sind es häufig entschiedene, jedoch gut getarnte Atheisten und Agnostiker, die in kirchlichen Beratungsstellen arbeiten, die in den Schulen Religionsunterricht erteilen, die feierliche Messen komponieren, religiöse Skulpturen herstellen oder die Drehbücher für religiös gefärbte Fernsehserien schreiben. Man sollte es den betroffenen Menschen nicht vorwerfen, dass sie diese chamäleonhafte Überlebensstrategie an den Tag legen, denn bekanntlich muss jeder von uns schauen, wo er bleibt (“Fressen kommt vor der Moral”). Eines jedoch sollte klar sein: Solange es nicht gelingt, den Einsatz für den weltlichen Humanismus auch in monetärer Hinsicht lohnend zu machen, wird die Zahl der Aktiven in der säkularen Szene weiterhin so klein bleiben, wie sie momentan ist.
Das Problem, vor dem wir hier stehen, hängt eng zusammen mit dem zunehmenden Auseinanderklaffen von gesellschaftlicher Wirklichkeit und den Institutionen, die diese repräsentieren sollen. Obgleich die Gruppe der Konfessionsfreien bekanntlich mittlerweile die größte “weltanschauliche Gruppierung”7 hierzulande ist (man kann es wirklich nicht oft genug wiederholen, dass es in Deutschland mehr konfessionsfreie Menschen als Katholiken oder Protestanten gibt!), spiegeln die gesellschaftlichen Institutionen noch die Verhältnisse der 1950er Jahre wider, in denen es in Westdeutschland nominelle Konfessionsfreie kaum gab. Eigentlich müsste unter Berücksichtigung des Gleichbehandlungsgrundsatzes schon heute auf jeden zweiten kirchlichen Arbeitsplatz ein weltlich-humanistischer kommen. In zehn bis fünfzehn Jahren (wenn jeder Zweite hierzulande voraussichtlich konfessionsfrei sein wird) müssten kirchliche und weltlich-humanistische Arbeitsplätze sogar in etwa gleich verteilt sein!
Von einem solchen Zustand sind wir natürlich meilenweit entfernt. Schon allein die Vorstellung, dass ein solcher Zustand irgendwann einmal erreicht werden könnte, klingt heute so hoffnungslos utopisch als würde die FDP als Wahlkampfziel anvisieren, die absolute Mehrheit in Bayern zu erringen. Dennoch sollte man nicht voreilig resignieren. Es gibt durchaus Belege, die darauf hindeuten, dass der Humanismus sehr wohl das Potential hat, sich institutionell in einem weit stärkeren Maße in Deutschland auszubreiten. Man beachte in diesem Zusammenhang etwa die enorme Entwicklung des Humanistischen Verbands Deutschland (HVD) in den letzten Jahren. Diese kam ja nicht von ungefähr, sondern ist darin begründet, dass die Verantwortlichen des HVD erkannten, dass es nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland sehr wohl eine starke Nachfrage nach dezidiert freigeistigen, humanistischen Dienstleistungen gibt.
Dieser bislang kaum erschlossene Markt ist längst noch nicht gesättigt, potentielle Nachfrager sind reichlich vorhanden, nur fehlt das entsprechende Angebot. Wie viele Eltern würden sich glücklich schätzen, könnten sie ihre Kinder in einen guten, modernste Forschungsergebnisse berücksichtigenden, weltlich-humanistischen Kindergarten oder eine ebensolche Schule schicken? Ihr Problem ist, dass sie kaum etwas Derartiges in ihrer Nachbarschaft finden werden. Deswegen ist jeder neu gegründete humanistische Kindergarten, jedes neu gegründete freigeistige Altenwohnheim etc. ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.
Ich bin sicher: Humanistische Dienstleistungen werden sich auf dem Markt Stück für Stück durchsetzen, wenn die Menschen praktisch erfahren, dass diese qualitativ den kirchlichen Angeboten überlegen sind. Denn warum suchen viele Kirchenmitglieder, wenn sie Partnerschaftsprobleme haben, lieber eine pro familia-Beratungsstelle auf als die kirchliche Äquivalenzeinrichtung? Weil sie den nicht unbegründeten Eindruck haben, dass sie dort kompetenter und vor allem dogmenfrei beraten werden. Qualität zahlt sich aus – und hier liegt der große Trumpf, den freigeistig-humanistische Träger künftig stärker ausspielen müssten.
Es gibt viele Bedürfnisse, die auf dem Markt derzeit noch nicht einmal annähernd befriedigt werden – und diese Bedürfnisse reichen im wahrsten Sinne von der Wiege bis zur Bahre. Um hier nur auf Letzteres kurz einzugehen: In der säkularen Gesellschaft ist die Angst vor dem Tod, von dem die Religionen einst profitierten, der Angst vor dem Sterben gewichen. Und diese Angst ist – wie wir alle wissen – keineswegs unbegründet. Es ist daher alles andere als erstaunlich, dass humanistische Patientenverfügungen (DGHS, HVD) so reißenden Absatz finden. Nicht auszudenken, welchen Erfolg erst gut geführte “Humanistische Sterbezentren” haben könnten, in denen man sich, versorgt mit den besten schmerzlindernden Medikamenten/Drogen, in schöner Umgebung (“Schöner sterben!”), ohne Versuche einer unnötigen Verlängerung des Leidens, selbstbestimmt und würdevoll von der Welt verabschieden kann. Ich bin überzeugt: Auf vielen Gebieten könnten freigeistige, wissenschaftlich, philosophisch wie künstlerisch aufgeschlossene Humanisten in der Praxis neue innovative Wege gehen – wären da nicht die vielen Hindernisse, die staatlicherseits solchen Unternehmungen entgegenstehen (man denke hier etwa an die Bemühungen bayrischer Ordnungshüter, die Gründung der ersten dezidiert humanistischen Schule in Nürnberg zu verhindern).8
Um diese Hindernisse Stück für Stück aus dem Weg zu räumen, bedarf es einer vernetzten Herangehensweise. Eben hierauf zielte der Vorschlag ab, den ich vor zwei Jahren in der MIZ (MIZ 1/04) unterbreitete. Ich schlug damals die Gründung zweier säkularer Institutionen vor: a) eines politischen Repräsentationsorgans (das ich “Zentralrat der Konfessionsfreien in Deutschland” nannte) sowie b) eines Bündnisses der praktisch-humanistischen Dienstleistungsanbieter (hier wählte ich das Etikett “Humanistischer Wohlfahrtsverband”). Während der Zentralratsvorschlag heftige Diskussionen entfachte, wurde der zweite Vorschlag kaum beachtet. Ich möchte an ihn daher an dieser Stelle noch einmal erinnern:
Wie ich damals ausführte, haben wir leider den geeigneten Zeitpunkt für die Gründung eines “Humanistischen Wohlfahrtsverbandes”, nämlich die sog. “Wiedervereinigung”, verpasst. Meines Ermessens spricht allerdings nichts gegen die Gründung einer “Humanistischen Forums” innerhalb des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, dem viele praktisch-humanistisch arbeitende Institutionen heute angehören. Selbstverständlich sollte der Wirkungskreis des Forums nicht auf den DPWV beschränkt bleiben. Es sollte auch mit kompatiblen Institutionen außerhalb des DPWV zusammenarbeiten, etwa mit der AWO, mit universitären Einrichtungen, privatwirtschaftlichen Trägern sowie mit gemeinnützigen Organisationen, die praktisch-humanistische Arbeit leisten, aber keinem der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege angehören.
Ziel des vorgeschlagenen “Humanistischen Forums” sollte sein, erstens zusätzlichen politischen Druck aufzubauen, um so die Rahmenbedingungen für praktisch-humanistische Arbeit zu verbessern (aufgrund seiner heterogenen Struktur ist der DPWV hierzu, so mein Eindruck, nicht in der Lage), sowie zweitens die Qualität praktisch-humanistischer Arbeit durch Erfahrungsaustausch und die Entwicklung entsprechender Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten zu erhöhen.
Mir scheint, dass die Veranstalter der Tagung “Es gibt nichts Gutes, außer: man tut es! – Praktischer Humanismus in Deutschland” (TU Berlin, 21.-22. Oktober 2006), auf die der Schwerpunkt dieser MIZ-Ausgabe zugeschnitten ist, ein Thema aufgegriffen haben, das weit bedeutsamer ist, als es so manchem auf den ersten Blick erscheinen mag. Denn wenn ich mich nicht irre, so steht und fällt das Projekt des weltlichen Humanismus in Deutschland nicht zuletzt mit dem Erfolg der Bemühungen um eine Ausweitung säkularer sozialer Dienstleistungen hierzulande. Zwar lässt sich der Anspruch des praktischen Humanismus ganz gewiss nicht auf den Dienstleistungssektor allein begrenzen (er hat selbstverständlich eine weit tiefer gehende politische Komponente!), aber als Motor für den aus humanistischer Sicht wünschenswerten gesellschaftlichen Transformationsprozess ist die Ausweitung des Angebots humanistischer Dienstleistungen von allergrößter Wichtigkeit.
Wie gesagt: Nicht hehre Ideale, sondern eigennützige Interessen bestimmen die Entwicklung einer Gesellschaft. Wer dies aus Gründen eines wie auch immer gearteten “weltanschaulichen Reinheitsgebots” (“In unserer Weltanschauung hat schnöder materieller Eigennutz nichts verloren!”) ignorieren möchte, der muss sich nicht nur den Idealismusvorwurf gefallen lassen, er wird sich auch damit abfinden müssen, dass er sein weltanschauliches Süppchen auch künftig im Kreise weniger Gleichgesinnter, d.h. auf Sparflamme weiterkochen muss. Wer tatsächlich etwas an den realen Verhältnissen verändern will, dem dürfte dies zu wenig sein.
Halten wir fest: Es reicht nicht aus, wenn das Gute nur auf dem Papier steht (auch wenn es, wie Ludwig Marcuse feststellte, natürlich besser ist, das Gute steht bloß auf dem Papier als nicht einmal dort!9). Wenn der Humanismus sich gegen die religiöse Konkurrenz durchsetzen soll, so muss er sich gerade auch in der Lebenspraxis lohnen, er sollte nicht nur theoretisch, sondern praktisch lebbar sein. Um es in den Worten des humanistischen Theoretikers und praktischen Therapeuten Erich Fromm auszudrücken: “Nur die Idee, die ‘Fleisch’ wird, kann einen Einfluss auf die Menschen ausüben, die Idee, die ein Wort bleibt, kann nur Worte ändern.”10
Anmerkungen:
1 Um Missverständnissen vorzubeugen: Eigennutz ist nicht das Gegenteil von Altruismus, sondern die Grundlage desselben, siehe hierzu Schmidt-Salomon, Michael: Manifest des evolutionären Humanismus. Aschaffenburg 2006, S. 17ff.
2 siehe hierzu das umfangreiche Datenmaterial der Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland, http://www.fowid.de.
3 Interessanterweise ist Benedikt XVI. entgegen der Annahmen der Fernsehanstalten nicht einmal ein besonders quotenfördernder “Promi”, siehe hierzu die Meldung 175 des Humanistischen Pressedienstes (hpd) “Ratzinger kein Quotenpapst” unter http://www.hpd-online.de.
4 Zum Begriff der “Zwangskonfessionalisierung” siehe Schmidt-Salomon, Michael: Von der Negation zur Position. Über die Notwendigkeit säkularer sozialer Dienstleistungen. In: MIZ 4/1997 oder humanismus aktuell 3/98.
5 vgl. Frerk, Carsten: Caritas und Diakonie in Deutschland. Aschaffenburg 2005.
6 Schmidt-Salomon, Michael: Das Feuerbach-Syndrom: Warum Religionskritik in der Wissenschaft noch immer ein Tabuthema ist. In: MIZ 2/04.
7 Dass es sich hierbei sehr wohl um eine durchaus homogene Gruppe handelt (homogener als die Gruppe der Kirchenmitglieder) wurde lange Zeit verkannt, siehe hierzu die in humanismus aktuell 18/2006 erschienenen Aufsätze: Frerk, Carsten: Empirie der Weltanschauungen; sowie Schmidt-Salomon, Michael: “Irgendwie sind wir doch alle Humanisten…” Über die soziale Verankerung und die Entwicklungspotentiale des Humanismus in Deutschland.
8 vgl. http://www.humanistische-schule.de
9 Marcuse, Ludwig: Argumente und Rezepte. Ein Wörterbuch für Zeitgenossen. Zürich 1973, S. 85.
10 Fromm, Erich: Jenseits der Illusionen. In: Fromm, Erich: Gesamtausgabe, Bd. IX. München 1989, S. 153.
M.S.S. zum Thema Religion und soziale Netzwerke
2 Beiträge
• Seite 1 von 1
2 Beiträge
• Seite 1 von 1
Zurück zu Religion & Spiritualität
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 11 Gäste